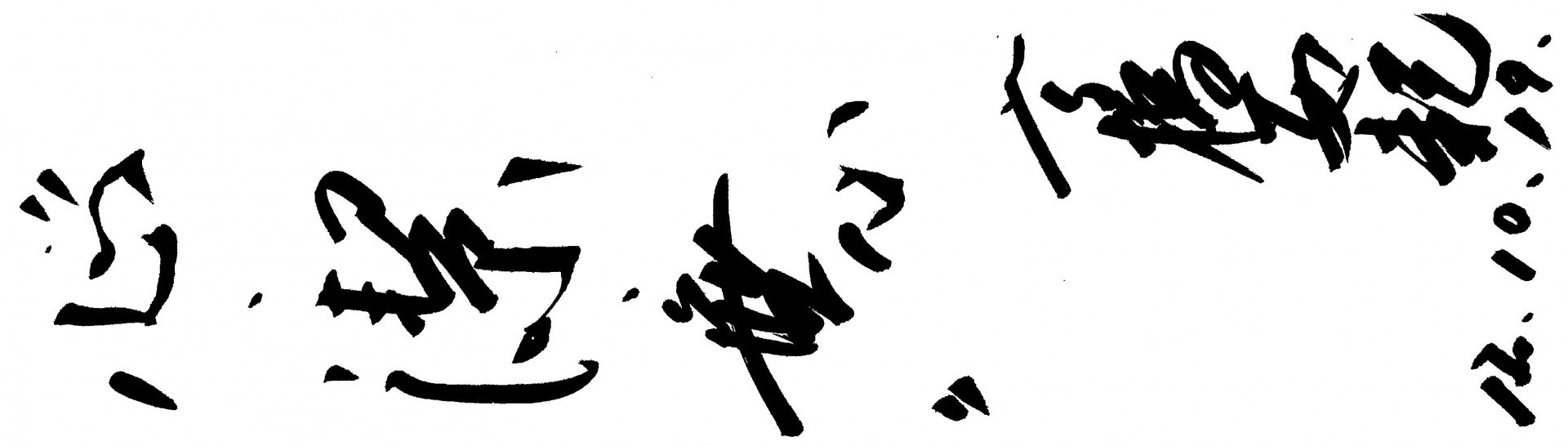Karate und Form
Bild: Lac Vert (1834 m) im Vallée Étroite, Département Hautes-Alpes, auf dem GR5 vom Genfersee ans Mittelmeer.
An der Langen Nacht der Museen fand ich in der Ausstellung “Trinkkultur — Kulturgetränk” im Völkerkundemuseum der Uni Zürich einen Text der in zweierlei Hinsicht zu Karate passt.
Einerseits, weil er eine mögliche Erklärung gibt, warum es manchmal beim Trainieren leer im Kopf wird.
Andererseits, weil eben, wenn es dann mal wieder nicht klappt, der zweite Teil des Textes zeigt, dass man formvollendet scheitern kann. Und Scheitern scheint irgendwie im Karate-Do eingebaut, damit man weiter wachsen soll…
Verwendung des Textes mit freundlicher Genehmigung des Museums für Völkerkunde.
Shiki soku ze kû
kû soku ze shiki
(Form ist Leere
Leere ist Form)
Aus dem Japanischen Text des Herz-Sutras
Diese Formel repräsentiert wie kein anderer Text jenen Kerngedanken, aus welchem das ästhetische Empfinden Japans erwuchs, dem das Ungesagte, der leere (Bild-)Raum nicht als Mangel und selbst Unzulänglichkeit nicht als Makel erscheinen. Sie spricht nicht von Dualismus esoterischer oder sprichwörtlicher Machart demzufolge der Weg nach Erreichen der Talsohle wieder ansteigt und Gegensätze sich anziehen, oder davon, dass Hochmut vor dem Fall kommt und dass sich liebt, was sich neckt. Sie besagt nur, was sie sagt:
Form ist Leere / Leere ist Form.
Der Text ist Teil eine Rezitation, die eng mit dem Zermoniell des Zen-Buddhismus verbunden ist und wie alle sprachlichen Zeugnisse des Zen weniger den Intellekt anspricht als vielmehr eine Praxis anregt, etwa die der spezifisch japanischen Trinkkultur mit ihren Regeln und Förmlichkeiten und deren vollständiger Auflösung schliesslich im Rausch — und mit ihren Gefässen.
Der jesuitische Missionar João Rodrigues lebte im 16. Jahrhundert mehrere Jahrzehnte lang in Japan und beobachtete dort, dass hochgestellte Persönlichkeiten bei feierlichen Trinkanlässen schmucklose, ungebrannte Trinkgefässe billigster Machart verwendeten — ein Umstand, den er der Macht alter Gewohnheiten zuschreibt. Er beschreibt, wie man sich vor dem Trinken zuerst die Lippen benetzen muss, um nicht am ungebrannten Ton der Trinkschale kleben zu bleiben, und wie zuweilen der Rand einer solchen Schale beim Trinken abbricht und etwas von dem Bier verschüttet wird, worauf sich der Trinkende lächelnd entschuldigt und das verschüttete Getränk aufwischt, während ihm ein neues Trinkschälchen gereicht wird. Was vielleicht weniger den Mächten alter Gewohnheiten geschuldet, sondern einer vergnügten Wertschätzung der Unvollkommenheit und Misslingen zu verdanken ist, denen es wiederum formvollendet zu begegnen gilt.